Entwicklung durch Schmerz.

Oder: Wie sich der Phoenix aus der Asche erhebt.
Im Buch haben meine Protagonisten nur eine begrenzte Anzahl von Seiten zur Verfügung, um ihre Entwicklung zu zeigen. Ich behaupte mal, dass diese im Normalfall (ohne außergewöhnliche Erlebnisse), einigermaßen linear verläuft. Da das weder spannend ist, noch die Handlung voranbringt, muss ein Booster her.
Dieser kann „persönliche Katastrophe“ heißen.
Auf die Idee für diesen Text kam ich durch einen Artikel über posttraumatisches Wachstum. Die Wissenschaftler Richard G. Tedeschi und Lawrence G. Calhoun haben untersucht, wie traumatische Ereignisse die Menschen reifen lassen.
Forscher glauben, dass die Überwindung der Krise das Potential in sich birgt, uns langfristig stärker und glücklicher werden zu lassen.
Unter anderem soll eine Ausnahmesituation uns Klarheit darüber verschaffen, was wir wirklich wollen. Ein weiterer Aspekt ist, dass der Fokus auf das hier und jetzt gelenkt wird. Dies führt zu mehr Achtsamkeit.
Außerdem können wir besser mitfühlen, wenn wir selber Schmerz erfahren haben. Das hilft uns bei sozialen Interaktionen. Auch tritt ein Glücksgefühl ein, wenn der Schmerz nachlässt. Dankbarkeit für das Schöne, dass wir haben, erfüllt uns.
Natürlich sagt keine der Studien, dass diese Effekte allgemeingültig sind. Auch nennt der britische Psychologe Stephen Joseph drei Grundvoraussetzungen, um diesen Effekt zu erhalten.
Auszug aus der Wikipedia:
*Man muss damit umgehen lernen, dass das Leben unsicher ist, und darf sich dabei nicht einschüchtern lassen.
Man muss bewusst mit den eigenen Emotionen umgehen, sie zunächst wahrnehmen, sie verstehen und akzeptieren. Dies führt zur emotionalen Selbsteinsicht und Reflexion.
Man muss zur Einsicht gelangen, dass man Verantwortung für sich, seine Taten und sein Leben trägt. Dabei darf man sich in der Krisensituation nicht als Opfer sehen. Die eigene Autonomie und Selbständigkeit muss klar wahrgenommen werden.
Martin Seligman und Ann Marie Roepke fügen noch einen vierten Punkt hinzu: Es ist wichtig, nach neuen Möglichkeiten und Optionen Ausschau zu halten und diese zu ergreifen. Frei nach dem Motto: „Wenn eine Tür zufällt, geht eine andere auf“.*
Ich halte das für eine schöne Basis, um die Figurenentwicklung im Roman anzulegen. Dabei denke ich nicht nur an Thriller oder Horror, wo das einschneidende Erlebnis durchaus blutig und gewalttätig sein kann.
Auch eine Romanze und sogar die Heimatschmonzette haben tragisches Potential.
Wenn meine Protagonistin siebzehn ist und zum ersten mal den heimischen Bauernhof und das beschauliche Dorf verlässt, wird das für sie ein einschneidender Moment sein. Sie wird Neues kennenlernen und bestimmt auch zweifeln und vielleicht auch scheitern.
Immer wieder liest man, dass die Figuren leiden sollen. Ich denke, dass nicht nur die spannende Situation, in der die Protagonistin durch die Hölle geht, wichtig ist. Es ist nur der erste Schritt einer Veränderung. Innerlich muss, äußerlich kann, die Figur nach dem erfolgreichen Überwinden des Problems ein wenig anders sein.
Eine Kriegerin, die zum ersten Mal einen Menschen getötet hat, wird das kaum so tun, als schlüge sie eine Fliege tot. Es macht etwas mit ihr. Dieses Etwas mitzuerleben, kann das Lesevergnügen beträchtlich steigern.
Außerdem bringt es uns die Protagonisten näher. In einer Stresssituation kommen Facetten von uns zum Vorschein, die bewundernswert, vertraut, anstößig oder gar abstoßend sein können.
Lese ich, wie der Hauptcharakter zurück in das brennende Haus rennt, um eine Katze zu retten, empfinde ich Sympathie. (Vorausgesetzt, es artet nicht in Kitsch aus). Stößt er auf seiner Flucht jedoch die Großmutter zur Seite, werde ich ihn augenblicklich als einen Antagonisten ansehen.
Mit diesem Effekt kann ruhig gespielt werden. Die zweite Person könnte so geschockt vom eigenen Verhalten sein, dass er in eine tiefe Krise stürzt, diese überwindet und zukünftig Wiedergutmachung leistet, indem er als einsamer Rächer die Stadt vom Bösen befreit.

Wichtig ist, dass die Figuren Stephen Josephs Grundvoraussetzungen erfüllen. Wenn sie an dem erlebten gänzlich zerbrechen, kommen Protagonisten heraus, die es einem schwer machen, sich mit ihnen zu identifizieren. (Außer natürlich, mein Buch spielt z.B. in einer psychiatrischen Klinik.)
Ebenfalls erwähnenswert finde ich den Gedanken, dass der Leser nicht das Gefühl haben sollte, dass die handelnden Personen erst mit dem ersten Wort im Buch erschaffen wurden. Sie sollten vorher da gewesen sein und nach der letzten Seite noch immer weiter existieren. (Wenn sie nicht nach Walhalla gefahren sind.)
Die Protagonisten starten also die Geschichte mit einem Päckchen an (teil/ un)- verarbeiteten Traumata verschiedener Größen.
Und sie beenden die Story mit dem, was sie gerade erlebt haben.
Natürlich kann es schwer sein, die Veränderung in der Persönlichkeit darzustellen. Aber vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, die Figur künftig emphatischer, nachdenklicher, böser, trauriger, liebevoller zu zeigen. Manchmal genügt ein Wort, oder eine Geste, um den aufmerksamen Leser wissen zu lassen, was Sache ist.
Wo die Reise der Protagonisten hingeht, entscheidet natürlich nur einer. Und das ist im besten Fall der Autor.
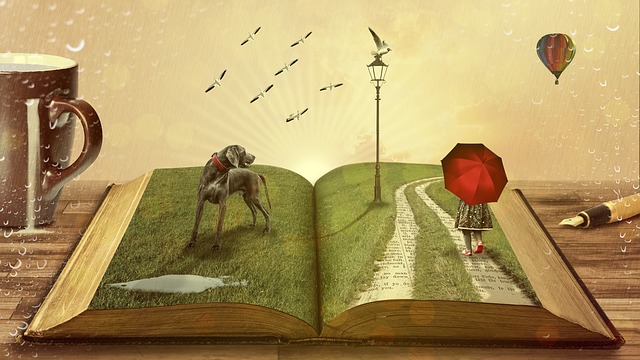
Bilder: pixabay.com